Autor Sepp Mall im Gespräch
Elisabeth Thaler: Was hat Dich veranlasst, Deinen Roman in der Optionszeit zu verankern und das Thema der NS-„Euthanasie“ an Südtiroler Kindern miteinzubeziehen?
Sepp Mall: Ich bin da irgendwie reingerutscht in diese Themen. Natürlich hat mich als Schriftsteller immer schon das Einwirken von Geschichte auf den Einzelnen interessiert. Und dann waren da Zufälle: In der Vorbereitung auf den Roman bin ich u. a. auf zwei Bücher gestoßen – Josef Feichtingers „Flucht zurück. Eine Auswandererkindheit“, in welchem er seine persönlichen Erinnerungen an die Option niedergeschrieben hat, und „Agnes, Ida, Max und die anderen“, eine Sammlung von Aufsätzen zur NS-Kinder-„Euthanasie“ in Südtirol. Die Schicksale, die hier dokumentiert bzw. erzählt werden, haben mich mich bewegt, auch schockiert – und letztlich war das wohl der Anlass, mich literarisch damit zu beschäftigen, also „meine“ Geschichte dazu zu erzählen.
Die Themen des Romans (Heimatverlust, Abschied, Sprachlosigkeit …) weisen über die Historie hinaus und schlagen eine Brücke ins Heute. Welche Denkanstöße wolltest Du in Bewegung setzen?
Ich habe beim Schreiben immer wieder daran denken müssen, dass vieles, was die „Optanten“ erlebt haben, sich heute überall auf der Welt wiederholt. Stichwort „Migration“. Auch viele der heutigen „Wanderer“ werden das Leid des Abschiednehmens erfahren so wie Ludi im Roman, genauso Skepsis und Ablehnung an den Orten, wo sie hinkommen. Auch die Versuche, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden und die oft unerfüllbaren Träume von einem besseren Leben, all das wiederholt sich auf die eine oder andere Weise.
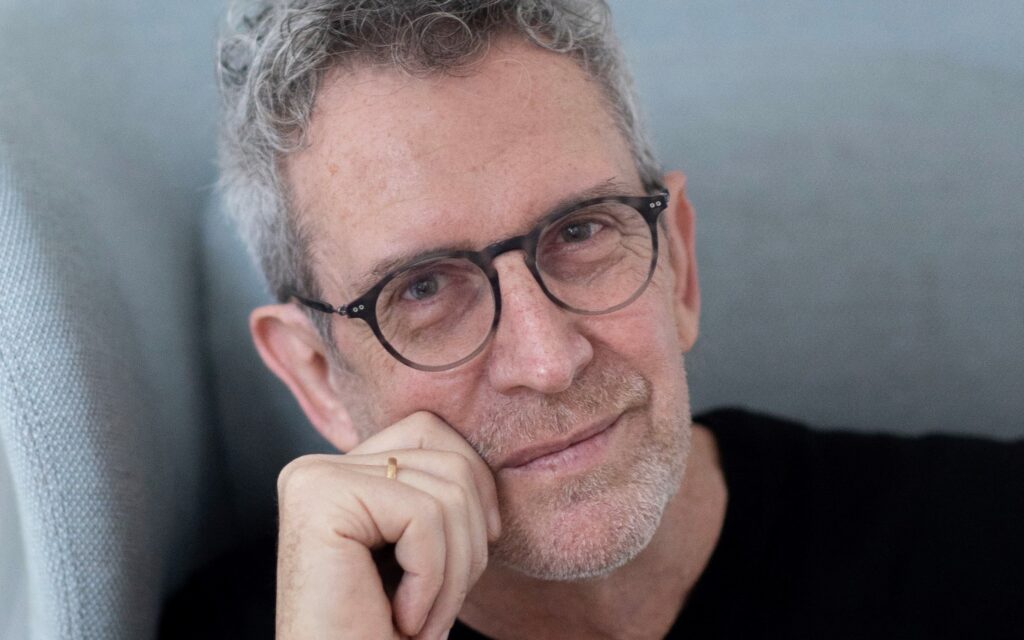
Foto: Minitta Kandlbauer
Das Buch ist aus der Perspektive des Kindes Ludi erzählt. Warum hast Du diese Erzählweise gewählt und welche Freiheiten hat sie Dir geschenkt?
Freiheiten, durchaus! Die „naive“, kindliche Darstellung der Umstände, des Krieges, der Brutalität und der vielen Abschiede im Zuge der Umsiedlung schien mir direkter und auch emotionaler als eine erwachsene, informierte Erzählung, somit vielleicht nachvollziehbarer. Zudem ergeben sich aus dem Nichtwissen oder Halbwissen des Kindes viele erzählerische Leerstellen, die Leserinnen und Leser mit ihren Kenntnissen oder Vermutungen füllen müssen. Ich habe also einiges an Interpretation anderen zuschieben können – etwa den Umgang mit ideologisierten Begriffen wie „Heimaterde“ oder die Geschichte mit dem „deutschen Blut“.
„Ein Hund kam in die Küche“ ist ein Baustein der Südtiroler Erinnerungskultur. Was bedeutet Dir Erinnerung?
Erinnerung ist einer der wichtigsten Grundlagen für das Handeln von uns allen. Nur aus der Erinnerung heraus, aus der persönlichen Erfahrung oder der kollektiven Erinnerung heraus verstehen wir, wer wir sind, was wir tun oder lassen sollen. Sie konstituiert in entscheidender Weise eine Persönlichkeit oder das Wesen eines Kollektivs. Keine Erinnerung zu haben an gestern, an die eigene Herkunft und im übertragenen Sinne an die Geschichte deiner Region, das hieße, keinen Boden unter den Füßen zu haben. Aber weil Erinnerung und die Bewahrung derselben oft auch trügerisch ist, wird halt alles etwas komplizierter…